Zur Ausgabe Nr. 6 (Sonderausgabe)
————————————————————————-
Entgegen unserer ursprünglichen Planung legen wir Ihnen dieses Mal, verehrte Leserinnen und Leser, eine Sonderausgabe von The Turn vor.
Als Thema dieser Ausgabe war zunächst »Dialektik der Vernunft« geplant. Beleuchtet werden sollte dabei insbesondere das Janusgesicht der Moderne. Der deutsche Soziologe Max Weber (gest. 1920) hatte darauf aufmerksam gemacht, dass der vermeintliche Sieg einer rationalen Weltdeutung über die religiösen Weltbilder eben nicht in das von den Aufklärern prognostizierte Reich der Vernunft münde, sondern dass ganz im Gegenteil ein Umschlag in den Irrationalismus drohe. Wie ist das zu verstehen? Der sinnhaft handelnde Mensch hat nach Weber auch ein Bedürfnis nach Sinn. Er (oder sie) kann sein (bzw. ihr) Leben so rational wie möglich gestalten, z. B. den Tag strukturieren, die Karriere planen oder versuchen, die Risiken des Lebens durch Versicherungen abzudecken. Der Mensch steht allerdings vor einem Problem, welches all sein rationales Handeln wertlos zu machen droht, nämlich die Gewissheit des Todes. Für Weber wird die Theodizeefrage, die bei ihm – im Gegensatz zur klassischen Theodizeefrage bei Leibniz – zur Sinnfrage an sich wird, die treibende Kraft des religiösen Rationalisierungsprozesses, mit dem der Mensch diese Frage zu beantworten sucht. Die rationale Wissenschaft hat sich als unfähig erwiesen, diese Welträtsel zu lösen und sie kann dem Menschen auch nicht sagen, wie er (moralisch) handeln soll. Das kann nur die Religion. Mit der Rationalisierung, Säkularisierung bzw. dem Entzauberungsprozess hat die »kulturelle Moderne« den Menschen damit konfrontiert, in einer gottlosen Zeit zu leben. Die Moderne bedeutet somit das Ende aller Sicherheit, selbst der Urteilssicherheit darüber, was gut und böse ist. Der Mensch bedarf aber eines Kompasses und Sinns, da sonst sämtliches Handeln wertlos erscheint. Weber zufolge hat sich im Abendland ein Rationalisierungsprozess vollzogen:
Die alten vielen Götter, entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen wieder ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser Leben und beginnen untereinander wieder ihren ewigen Kampf. Das aber, was gerade dem modernen Menschen so schwer wird, und der jungen Generation am schwersten, ist: einem solchen Alltag gewachsen zu sein. Alles Jagen nach dem Erlebnis stammt aus dieser Schwäche.[1]
Weber hat hier dargestellt, unter welchen Schwierigkeiten die Menschen im Westen ihr Leben meistern müssen, auch wenn sie im Vergleich einen hohen Lebensstandard genießen, da ihnen das »geistige Brot«, das Spirituelle, fehlt. Die heute verbreitete Erlebnisorientierung wurde von Weber im vorherigen Zitat direkt angesprochen. Durch den Bedeutungsverlust der traditionellen Religionen wächst auch die Sucht nach – rationalen und irrationalen – Ersatzreligionen. Daher steht mit der Aufklärung und dem abendländischen Rationalisierungsprozess nicht unbedingt der Aufbruch ins lichte Vernunftreich bevor, sondern es droht der Umschlag in den Irrationalismus. Weber hat hier in gewisser Weise auch das Aufkommen des Nationalsozialismus, der ja alle Merkmale einer Ersatzreligion aufweist, vorhergesehen. Detlev Peukert formulierte es wie folgt: »Der Nationalsozialismus ist insofern eine, wohl die fatalste Entwicklungsmöglichkeit der Moderne.«[2]
Wie diese einleitenden Gedanken zeigen, versprachen das Thema der Janusköpfigkeit der Moderne und die dafür geplanten Beiträge eine interessante Ausgabe. Verschiedene unvorhergesehene Umstände führten allerdings dazu, dass sich die Fertigstellung mehrerer Artikel verzögerte und schwierig gestaltete. Dies führte letztlich dazu, dass die Redaktion sich dazu entschloss, statt des ursprünglich geplanten Themas eine Sonderausgabe von The Turn vorzulegen.
Für diese Ausgabe blieben daher aus der ursprünglichen Planung gewissermaßen nur zwei Beiträge übrig, von denen einer der von Detlef Thiel ist, mit dem Titel »Zur Genese des Begriffs Dialektik«, worin der Autor die Entstehungsgeschichte des Begriffs »Dialektik« zu beleuchten versucht. Darin zeigt er auf, wie die Dialektik anfangs den Dialogen Platons entsprungen ist und bei diesem antiken Philosophen lediglich als eine philosophische Gesprächstechnik fungierte, mit der man bestrebt war, zur Wahrheit zu gelangen. Die Sophisten und andere Strömungen wiederum missbrauchten diese Technik, weil es ihnen nicht mehr um die Suche nach der Wahrheit ging, sondern lediglich darum, mithilfe einer Gesprächsführungstechnik Recht zu behalten. Dennoch erhob Platon nach der Darstellung des Autors die Dialektik zur Mutter aller Wissenschaften, da er darin eine Möglichkeit sah, das Ideenreich dialektisch zu durchschreiten, um letztlich zum Telos, der Idee des Guten, zu gelangen. Diese zweite »Spielart« der Dialektik mündete dann bei den Neuplatonikern Plotin und Proklos in eine henologische Reduktion, bei der mittels Dialektik letztlich alles Denken in der ekstasis überschritten wird, so dass »alle Dialektik in Mystik übergeht, weil die ekstasis nun zu einer Einswerdung mit dem Einen, einer henosis, wird«. Dabei gelte das absolute Eine als nicht mehr positiv bestimmbar, sondern könne ausschließlich durch ein negatives Ausgrenzungsverfahren beschrieben werden. So erreichte die Dialektik ihren ersten großen Höhepunkt, geriet aber hiernach dem Autor zufolge auch wieder in Vergessenheit, bis der Dialektik-Begriff im Mittelalter und der Neuzeit zu neuer Bedeutung kam, wie Detlef Thiel in seinem Ausblick am Beispiel von Hegel und Marx kurz umreißt.
Der zweite Artikel, der sich ebenfalls mit der Dialektik befasst, stammt von Ronen Pinkas, der in seinem Beitrag »On prayer and dialectic in modern Jewish philosophy« die zentrale Bedeutung der Dialektik im Denken jüdischer Philosophen vom Beginn der Moderne bis zur Gegenwart deutlich macht. Der Autor stellt dar, wie einige moderne jüdische Gelehrte die zentrale Bedeutung der Dialektik im Judentum hervorgehoben haben, so dass man das Judentum sogar als »dialektische Religion« bezeichnen könne, während er gleichzeitig auf die dialektischen Spannungen innerhalb des Judentums Bezug nimmt. Dabei erwähnt er auch die kritischen Positionen gegenüber verschiedenen Aspekten der Hegelschen Dialektik, die zum Beispiel von Hermann Cohen, Franz Rosenzweig oder Martin Buber vertreten wurden. Grundsätzlich geht der Autor in seinem Beitrag von zwei philosophischen Annahmen aus, nämlich zum einen, dass es einen Unterschied zwischen zwei Erkennungsmustern gibt: dem dialektischen und dem dialogischen, und zum anderen, dass die Ursprünge des dialogischen Musters in der Beziehung zwischen Mensch und Gott zu finden seien, einer Beziehung, in der das Gebet eine wichtige Rolle spiele und die gleichzeitig ein Paradigma für die menschlichen Beziehungen darstelle. Beide Annahmen betrachtet er im Spiegel des Denkens von Hermann Cohen und Franz Rosenzweig als zwei der einflussreichsten jüdischen Philosophen, deren Positionen zur Dialektik und zum Gebet er eingehend untersucht, um hierin ihre diesbezüglichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzudecken und herauszuarbeiten. Beide Philosophen nutzen das dialektische Denken, kritisieren es aber auch, was sich dem Autor zufolge auch an ihrer Betrachtungsweise hinsichtlich des Gebets ablesen lässt, die zeige, dass beide eine relationale und dialogische Denkweise einer dialektischen vorziehen, ohne jedoch auf letztere zu verzichten.
Von der Dialektik weg hin zum Thema »Willensfreiheit und Determinismus« bewegt sich der Beitrag von Mona Jahangiri, die darin mit ihren zunächst neuroethischen Betrachtungen der Tatsache Rechnung trägt, dass auf dem Gebiet der Neurowissenschaften rasante Entwicklungen stattfinden. Infolgedessen werden verstärkt ethische Fragen im Bereich der Hirnforschung aufgegriffen: Gibt es eine Willensfreiheit? Ist der Mensch in seinen Handlungen frei oder sind seine Handlungen determiniert? In ihrem Artikel untersucht die Autorin die Frage nach der moralischen Verantwortung bei Straftätern sowie die dieser Frage zugrundeliegende Problematik der menschlichen Willensfreiheit, der sie sich aus islamischer, insbesondere islamisch-schiitischer Perspektive und auf interdisziplinäre Art und Weise nähert. Ob der Mensch in seinen Handlungen tatsächlich frei ist oder nicht, diskutiert sie zunächst anhand einiger zu diesem Thema beispielhaft ausgewählter Stellungnahmen seitens anglo-amerikanischer und europäischer Philosophen und Neurowissenschaftler. Dem folgt eine Darstellung über »Schuld und Verantwortung in Koran und Hadith«, bevor sie sich ausführlich dem Thema »Determinismus und Freiheit in der islamisch-schiitischen Philosophie« widmet und hierzu die verschiedenen Positionen wiedergibt, die innerhalb der Geschichte und Wissenschaft des kalām immer wieder neu diskutiert und auf den Prüfstand gebracht wurden. Dabei macht sie deutlich, dass die islamisch-schiitische Sichtweise in Bezug auf die Frage nach der göttlichen Vorherbestimmung und menschlichen Willensfreiheit einen »Mittelweg« bereithält, der in dieser Hinsicht kein Entweder-Oder bedeutet, sondern vielmehr ein Sowohl-als-auch, das nach ihrem Dafürhalten die Grundlage für eine spezielle Art des Kompatibilismus darstellt, bei dem »jeder Mensch vollkommene Verantwortung für seine Taten trägt und als ihr Urheber zu gelten hat, auch wenn er keine absolute, vollkommene Willensfreiheit besitzt und auch wenn die Ursachen nicht hundertprozentig in seinem Machtbereich liegen«.
Auch der Beitrag »ʿAllāma al-Ḥillī und seine Handlungstheorie« von Sedigheh Khansari Mousavi greift die Frage nach der menschlichen Willensfreiheit auf und diskutiert diese am Beispiel der Handlungstheorie des islamisch-schiitischen Gelehrten ʿAllāma al-Ḥillī (gest. 1325) und seinem Traktat Istiqṣāʾ an-naẓar fī l-qaḍāʾ wa-l-qadar. Doch bevor die Autorin auf dieses Werk näher zu sprechen kommt, gibt sie einen kurzen historischen Überblick über verschiedene muslimische Denkströmungen und kalām-Schulen, indem sie deren jeweilige Methodik und Position zur Handlungstheorie vorstellt und die in diesem Zusammenhang geführte Debatte über die »göttliche Prädestination und menschliche Willensfreiheit« erörtert. Hiernach wirft sie einen genaueren Blick auf die »kalām-Schule von al-Ḥilla«, deren prominentester Vertreter und Wegbereiter ʿAllāma al-Ḥillī war und die innerhalb des imamitischen kalām laut der Autorin zwei Strömungen vereinte, nämlich die rationale Strömung der kalām-Schule von Bagdad und die textorientierte Strömung der Schule von Qum. Beide Strömungen kommen auch im Denken und Werk von ʿAllāma al-Ḥillī zusammen und prägen seine Schrift Istiqṣāʾ an-naẓar fī l-qaḍāʾ wa-l-qadar, in der er mithilfe einer rationalen und textorientierten Beweisführung das vieldiskutierte Problem der Handlungstheorie zu lösen versucht. Damit begegnet er einem theologischen Thema mit philosophischen Methoden, wie es nach Darstellung der Autorin vor ihm auch bereits Abū al-Ḥasan al-ʿĀmirī (gest. 992) mit seinem Werk Inqāḏ al-bašar mina l-ǧabr wa-l-qadar getan hat, so dass hier Theologie und Philosophie und damit Offenbarung und Vernunft nicht als Gegensätze betrachtet werden, sondern als zwei sich gegenseitig bestätigende Wege, die »das gleiche Ziel verfolgen, nämlich die göttliche Wahrheit zu entdecken«.
Von der Wissenschaft des kalām hin zur Wissenschaft der Koranexegese führt uns der Beitrag »Intratextuelle Koranexegese« von Nour Khalife, die darin im Rahmen ihrer Abschlussarbeit zur Erlangung eines Bachelorgrades die Methode der Auslegung des Korans durch den Koran (tafsīr al-Qurʾān bi-l-Qurʾān) am Beispiel des umfangreichen und neuzeitlichen Korankommentars al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān von dem iranischen Gelehrten und Philosophen Sayyid Muḥammad Ḥusain Ṭabāṭabāʾī (gest. 1981) darstellt und untersucht, inwieweit diese Methode tatsächlich in Bezug auf den genannten Korankommentar zutreffend ist und ihn geprägt hat. Dabei greift die Autorin wesentliche Aspekte der intratextuellen Koranexegese auf, die im Gegensatz zur intertextuellen Koranexegese bisher in dieser Form scheinbar von wenigen Koranexegeten angewendet wurde, worin die Autorin auch die Bedeutung ihrer Forschungsarbeit sieht, und reflektiert zunächst wichtige Prinzipien sowohl der sunnitischen wie schiitischen Koranauslegung, bevor sie genauer auf die entsprechenden Grundlagen und Regeln der Methode des tafsīr al-Qurʾān bi-l-Qurʾān eingeht. Dass sie dann im Anschluss gerade den Korankommentar von Ṭabāṭabāʾī bespricht und seinen Aufbau sowie seine Methode analysiert, sieht sie der Tatsache geschuldet, dass seine Kommentierung innerhalb der schiitischen Konfession eine große Reichweite und besondere wissenschaftliche Anerkennung erlangt hat, während sie außerhalb der schiitischen Forschung und Wissenschaft im Vergleich bisher noch unzureichend behandelt wurde. Den wohl wichtigsten Teil ihrer Arbeit vollzieht sie im letzten Kapitel anhand eines praktischen Auslegungsbeispiels, das sich auf die 114. Sure des Korans, Sūrat an-nās, bezieht und an dem sie zeigt, wie Ṭabāṭabāʾī bei seiner intratextuellen Exegese genau vorgeht und welche anderen Gesichtspunkte, wie philosophische, mystische und soziologische, bei seiner Interpretation des Korans ebenso eine Rolle spielen.
Damit schließt die vorliegende Sonderausgabe von The Turn, die dem ursprünglich geplanten Thema »Dialektik der Vernunft« aufgrund oben genannter Umstände zwar nur zum Teil Rechnung tragen kann, dies aber umso mehr mit zwei sehr aufschlussreichen und interessanten Beiträgen, die dieses Thema wissenschaftlich tiefgehend beleuchten. Und auch wenn die anderen Beiträge in ihrer Wissenschaftlichkeit thematisch nicht direkt auf die Dialektik Bezug nehmen, so treten sie in gewisser Weise dennoch alle gemeinsam in einen Dialog miteinander und vermögen – ganz im Sinn der (platonischen) Dialektik – zu neuen Erkenntnissen zu führen.
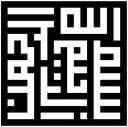
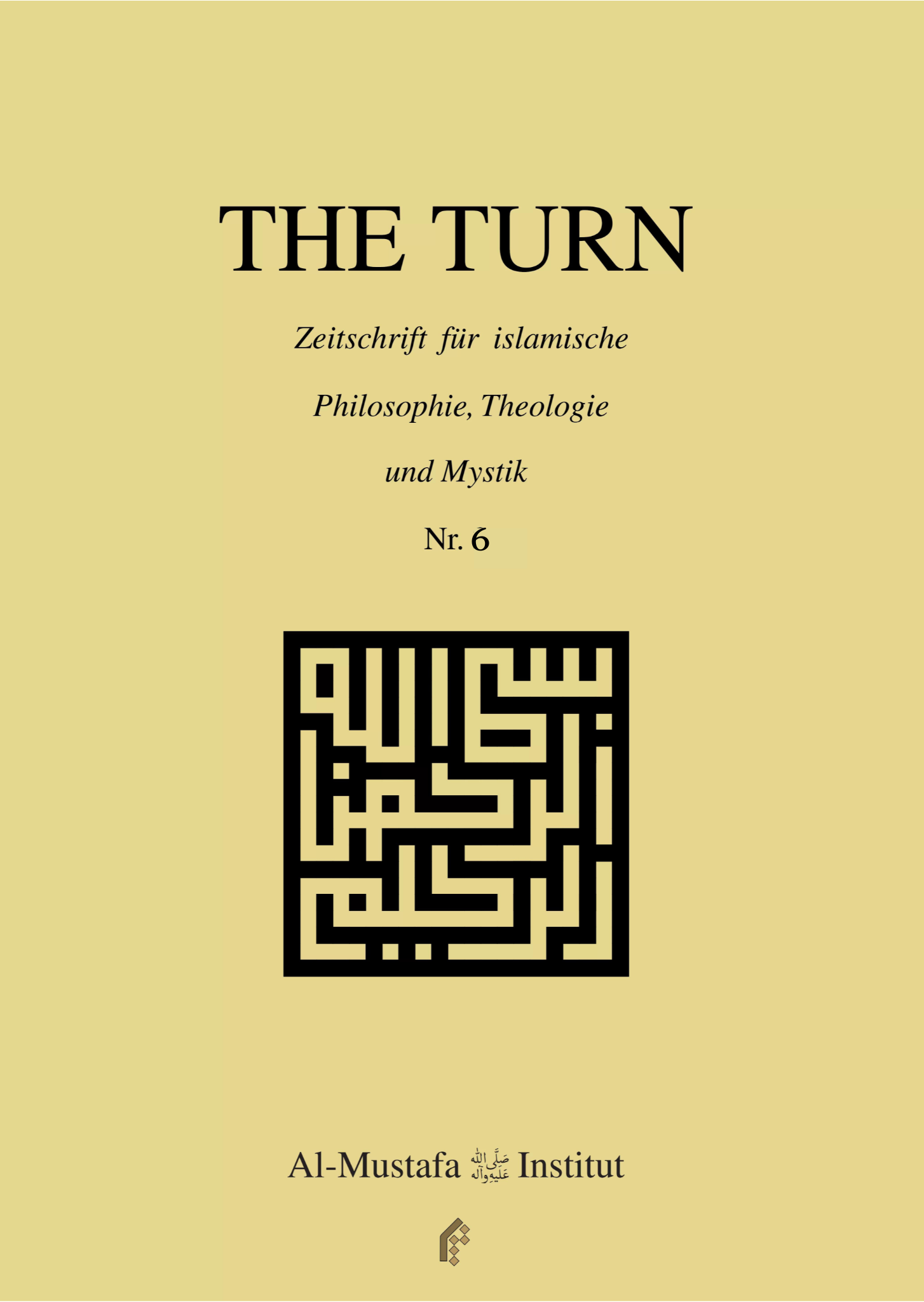
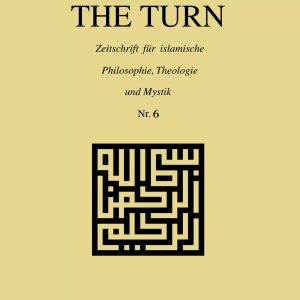
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.